Inhalt der Seite:
Abbildung Mars
Abbildung Kanäle -
doppelt
Abb. Info
Text - infos
Text
Der Zustand der
Gestirne
Die Sterne
Leben der
Sterne, Supernova
Die Planeten
Der Mars
Der Mars als
Lebensraum
Bewohnbarkeit
Allgemein
- - -
Seite
+
Inhalt
mehr geovirtual
[*1]: Friedrich Argelander, deutscher Astronom, 1799 – 1875, arbeitete in Finnland und Deutschland, er bestimmte für tausenden von Sternen ihre Position sowie scheinbare Helligkeit und kartographierte sie, eine sogenannte „Durchmusterung“.
[*2]: Giovanni Schiaparelli (1835 - 1910), italienischer Astronom und Ingenieur, befaßte sich schwerpunkt-mäßig mit Planeten Observationen. Am bekanntesten wurden seine Marskanäle, welche auch von vielen anderen Astronomen bestätigt wurden. Später stellte sich heraus das es sich in den meisten Fällen um optische Täuschungen handelte.
[*3]: Angelo Secchi, 1818 – 1878; italienischer, Jesuit, Astronom und Physiker, Pionier der Spektralanalyse an Gestirnen.
[*4]: Lick Observatorium in Kalifornien wurde 1888 eingeweiht, und war eines der modernsten seiner Zeit. Bis 1897 besaß es das größte Teleskop.
Der Mars als “Lebensraum” wurde bis um 1960 angenommen: Kanäle, Farbveränderungen und sogar der Nachweis von Spektrallinien des Wassers (welche sich später als falsch herausstellten) waren starke Argumente.
Foto/Scan - Digital Bearbeitet: (W.Griem, 2007, 2019); von: M.Neumayr / V.Uhlig (1897) "Der Zustand der Planeten - mit den Marshemisphären und die Verdoppelung der Marskanäle
Abb. 65: Die Marshemisphären Zeichnung nach Schiaparelli
Neumayr, M. Uhlig, V. (1897): Erdgeschichte. -
Band 1: 692
Seiten, 378
Abbildungen; Band 2: 700 Seiten, 495 Abbildungen, Verlag Bibliographisches Institut,
Leipzig und Wien.
[Sammlung W. Griem]
Die Abbildungen wurden mit einem HP
Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo
Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der
Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der
Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).
Die Texte wurden mit einer Pentax
Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur
OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in
ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version
14.
Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es
wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W.Griem, 2020).
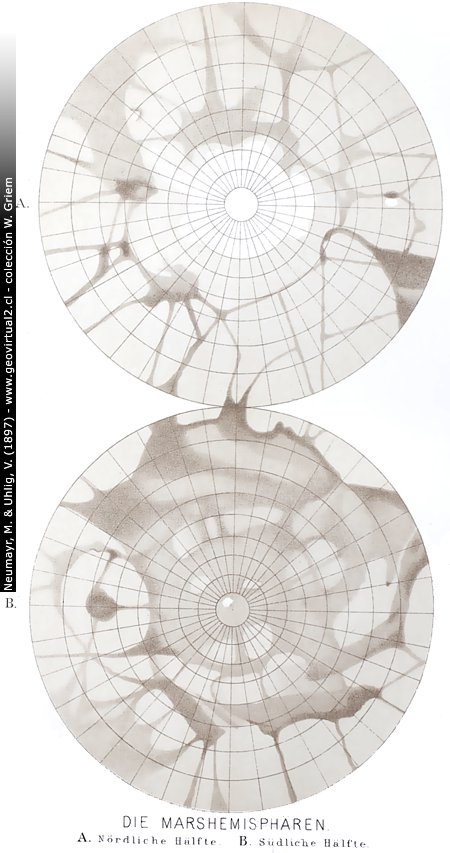
Eine Karte der Marshemisphären zeigt die deutliche Überbewertung der sogenannten Marskanäle, heute kann von einer Überinterpretation gesprochen werden. Die Kanäle wurden von anderen Wissenschaftlern bestätigt, und hielten sich bis ungefähr 1960. Die Interpretation der Kanäle als Bauwerke einer Zivilisation wurde von den Wissenschaftlern nicht vorgenommen, dies geschah nur in einigen (zwielichtigen) Pressemitteleilungen .
Text in Deutsch:
Originaltext von Neumayr & Uhlig, 1897:
p.78 im Original - p. 100 in der OCR-Version
Der Zustand der Planeten - Der Mars (eine optimistische
Interpretation....)
Der Zustand der Gestirne.
Die Sterne
Wir dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß in ungefähr
demselben Zustand wie die Sonne sich auch die übrigen gelben Sterne
befinden, zu welchen die Sonne ja auch gerechnet werden muß, und wir
haben hier ein weiteres Stadium in dem Entwickelungsgang kennen gelernt,
welchen die sich abkühlenden Himmelskörper durchlaufen. Einen Schritt
weiter führt uns die Betrachtung der roten und meist veränderlichen
Sterne, welche Secchi als seinen dritten und vierten Typus der Fixsterne
anführt. Wie wir gesehen haben, sind die Spektra dieser Körper durch das
Auftreten breiter dunkler Streifen, der sogenannten Kolonnaden,
charakterisiert und zeigen Eigentümlichkeiten, die auf das Vorhandensein
chemischer Verbindungen in großer Menge Hinweisen. Während auf den
weißen und gelben Sternen die Hitze eine so bedeutende zu sein scheint,
daß chemische Verbindungen nicht existieren können, sondern die Elemente
in freiem Zustand vorhanden sind, muß die Abkühlung auf diesen roten
Gestirnen so weit vorgeschritten sein, daß keine allgemeine
„Dissoziation" der Grundstoffe mehr stattfindet. Zu demselben Schlusse,
zu der Annahme einer niedrigeren Temperatur auf den in Rede stehenden
Weltkörpern, führt uns der Umstand, daß sich unter denselben sehr viele
von veränderlicher Lichtstärke finden. Allerdings können nicht alle
derartigen Schwankungen des Glanzes aus denselben Ursachen, nicht alle
auf Abkühlung zurückgeführt werden. Manche zeigen sehr regelmäßig
periodische Veränderungen, für welche jedenfalls die einfachste und
natürlichste Erklärung die ist, daß sie von einem großen dunkeln
Satelliten begleitet werden, der, in gewissen Perioden vor ihnen
vorübergehend, sie teilweise bedeckt und verfinstert. In anderen Fällen
aber ist die Ansicht offenbar gerechtfertigt, daß wir es mit äußerst
starker Fleckenbildung zu tun haben oder mit schon vollzogener Bildung
von erstarrten Kontinenten in dem Glutmeer flüssigen Materials.
Das Leben der Sterne bis zu einer Supernova:
Daß in diesem Gangs der allmählichen Abkühlung und Verdunkelung sich
bisweilen überaus heftige Katastrophen einstellen, beweisen die
sogenannten neuen oder plötzlich aufleuchtenden Sterne; das bekannteste
Ereignis dieser Art stellte der vielgenannte Stern Tycho Brahes, des
berühmten dänischen Astronomen aus dem 16. Jahrhundert, dar. Tycho
erblickte eines Abends zu seinem größten Erstaunen nahe am Zenith im
Sternbild der Kassiopeia einen hell leuchtenden Fixstern von nie
gesehener Größe. Der merkwürdige Fremdling erschien am 11. November 1572
im hellsten Glanze mit weißem Licht, im Aussehen ganz einem Fixstern
ähnlich, aber weit Heller als irgend einer von diesen und die Venus an
Helligkeit erreichend; allein bald trat eine Verminderung ein, schon im
Dezember desselben Jahres war er nur noch dem Jupiter gleich und im
Februar und März 1573 einem gewöhnlichen Stern erster Größe mit gelber
Farbe. Ende März nahm er rotes Licht an, ähnlich dem des Mars, im April
und Mai sank er zur zweiten Größe herab, im Juli und August zur dritten,
im Oktober und November zur vierten. Der Übergang von der fünften zur
sechsten Größe fand vom Dezember 1573 bis Februar 1574 statt, und später
verschwand der neue Stern, der wieder weiße Farbe angenommen hatte, dem
freien Auge vollständig, nachdem er im ganzen 17 Monate lang sichtbar
gewesen war. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er identisch mit einem
teleskopischen Sternchen zehnter oder elfter Größe, das Argelander [*1]
fast genau an der von Tycho bezeichneten Stelle fand.
Ähnliche Erscheinungen wurden noch mehrmals beobachtet; der sogenannte
Keplersche Stern wurde am 10. Oktober 1604 im Sternbild des
Schlangenträgers entdeckt, er erreichte an Glanz fast die Venus, war
aber im März 1606 selbst für sehr scharfe Augen nicht mehr sichtbar. In
der Nacht des 12. Mar 1866 entdeckten Julius Schmidt in Athen und John
Birmingham in Irland im Sternbild der Nördlichen Krone plötzlich einen
sehr Hellen Stern, der vorher nicht vorhanden war; noch in derselben
Nacht verminderte er seine Lichtstärke und war nach acht Tagen mit dem
bloßen Auge nicht mehr zu erkennen. Genaue Bestimmungen des Ortes
zeigten, daß dieser Stern schon lange von Argelander als der neunten bis
zehnten Größe angehörig verzeichnet war, und mit derselben
Lichtintensität ist er auch heute wieder sichtbar. Ein ähnlicher Fall
wurde im Jahre 1876 von Julius Schmidt im Sternbild des Schwanes
entdeckt. Endlich flammte im August 1885 mitten im Andromeda-Nebel ein
neuer Stern sechster Größe auf, welcher schon im Jahre 1886 zur zwölften
Größe herabgesunken und allmählich gänzlich unsichtbar geworden war.
Wegen der überaus regelmäßigen Abnahme der Lichtstärke hält es Seeliger
für wahrscheinlich, daß eine plötzliche Erwärmung, vielleicht durch den
Einsturz eines dunkeln, festen Gestirns hervorgerufen, die Ursache des
Aufleuchtens war. Man muß daher auch diesen Vorgang als Veranlassung zur
Bildung „neuer" Sterne im Auge behalten.
Die Beobachtungen des Fixsternhimmels zeigen uns keine weiteren Stadien
des Abkühlungsprozesses als die bisher betrachteten; Körper, die noch
geringere Temperatur besitzen als Secchis [*3] dritter und vierter Typus,
brauchen durchaus nicht ganz dunkel zu sein, aber ihr Glanz ist doch zu
gering, um aus jenen unermeßlich fernen Himmelsräumen bis zu uns zu
dringen. Wollen wir weitere Vergleichspunkte finden, so müssen wir in
unserem Planetensystem Umschau halten, dessen Glieder nur im Widerschein
des Sonnenlichts glänzen.
Die Planeten
Für die vier äußeren großen Planeten: Neptun,
Uranus, Saturn und Jupiter, scheint dies allerdings nicht vollständig
richtig zu sein, denn die neueren Untersuchungen machen es in hohem
Grade wahrscheinlich, daß sie neben dem ganz überwiegenden reflektierten
Lichte der Sonne auch in sehr geringen: Maße eigenes Licht ausstrahlen;
dieselben wären demnach noch in einem wenn auch schwach glühenden
Zustand. Ob sie gasförmig, flüssig oder fest seien, läßt sich nicht mit
Bestimmtheit sagen; nur so viel ist sicher, daß ihre Dichtigkeit eine
ziemlich geringe ist. Die Atmosphäre dieser Planeten wurde schon bei der
Besprechung der Spektralanalyse erwähnt, ebenso bereits früher des
bekannten Ringes gedacht, welcher den Saturn umgibt; nur kurz heben wir
die eigentümlichen streifigen Flecke hervor, die einen großen Teil der
Oberfläche des Jupiter bedecken und bisher als Wolkenbildungen gedeutet
wurden, während Barnard auf Grund langjähriger Beobachtungen neuerlich
annimmt, daß sich die Oberfläche in einen: plastischen, teigartig
weichen Zustand befinde. Die Streifen sollen in Wirklichkeit
Farbenveränderungen zuzuschreiben sein, welche durch innere Eruptionen
verursacht werden. Jupiter würde uns, wenn diese Anschauung sich
bestätigen sollte, das Abbild einer alternden, langsam erlöschenden
Sonne darbieten.
Über die zahlreichen Asteroiden ist wenig zu bemerken; an den größten
unter ihnen, besonders an Vesta, sind Spuren einer Atmosphäre entdeckt
worden.
Von um so größerem Interesse sind die Beobachtungen an den Planeten
innerhalb des Gürtels der Asteroiden, oder wenigstens an einen: von
ihnen, an Mars, während Venus und Merkur, deren Bahnen zwischen Sonne
und Erde liegen, nur wenige Daten geliefert haben.
Der Mars:
Mars, der äußerste
unter den vier sonnennahen Planeten, ist von zwei kleinen Monden
begleitet; seine mittlere Entfernung von der Sonne beträgt ungefähr 31
Millionen Meilen, ist also um mehr als die Hälfte größer als die der
Erde, so daß er nicht ganz halb soviel Licht und Wärme von der Sonne
erhält wie diese. Die Bahn ist eine verhältnismäßig sehr exzentrische:
sie nähert sich in der Sonnennähe dem Zentralkörper auf 28 Millionen
Meilen und steht im entgegengesetzten Falle 33 Millionen Meilen von
demselben ab. Der Durchmesser des Mars beträgt 908 Meilen, etwas mehr
als die Hälfte von dem der Erde, seine Oberfläche 3/10, sein Volumen
1/7, seine Masse 1/10 von derjenigen der Erde. Der Umlauf um die Sonne,
das Marsjahr, dauert fast 687 Tage, während die Umdrehung um die eigene
Achse sich auf 24 Stunden, 37 Minuten und 24 Sekunden beläuft.
Untersuchungen über die Beschaffenheit des Mars sind schon vielfach
gemacht worden; namentlich hat Schiaparelli [*2] die günstigen
Bedingungen, welche sich in den Jahren 1877, 1879, 1882 und 1888 boten,
benutzt, um genaue Studien in dieser Richtung zu machen. Wir verdanken
dem Mailänder Astronomen äußerst interessante Aufschlüsse über diesen
merkwürdigen Planeten (vgl. die beigeheftete Tafel „Die
Marshemisphären")
Auf der Oberfläche des Mars findet man hauptsächlich zweierlei
Bestandteile, nämlich hellere, gelbe oder rote und dunklere, eisengraue
oder schwarze Stellen, welche in ihrer Lage und Begrenzung im
allgemeinen keine Veränderungen erleiden. Die ersteren Partien
betrachtet man als Festland, die letzteren als Meer. Bei einem Vergleich
mit der Erde ergibt sich vor allem, daß das Verhältnis vom Meere zum
Festland ein sehr verschiedenes ist, indem das vom Wasser bedeckte Areal
auf den: Mars viel geringer ist als bei uns und kann: die Hälfte der
ganzen Oberfläche einnimmt. Trotzdem gibt es aber keine großen
Kontinente auf dem Mars sondern alles Land besteht aus einer sehr
bedeutenden Anzahl ansehnlicher Inseln, die durch Meereskanäle
voneinander getrennt werden und namentlich um den Äquator und auf der
nördlichen Hemisphäre angehäuft sind, während um den Südpol offeneres
Meer vorhanden ist.
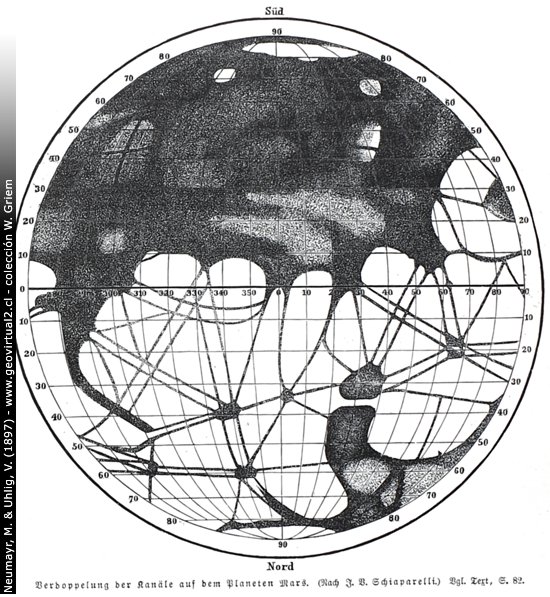
Abb. 66: Die Verdoppelung der Marskanäle - Neumayr & Uhlig
Das Meer zeigt von einer Mars-Opposition zur anderen, ja im Laufs
desselben Jahres merkliche Farbenänderungen; außerdem enthält es Stellen
unbestimmten Charakters, die sich zeitweilig als Festland darstellen,
dann wieder als Meer, und welche man als Untiefen betrachtet. Manche von
den Flächen, die das Meer verläßt, überziehen sich nach Pickering sehr
rasch mit einer grünen Farbe, welche den Eindruck macht, als rühre sie
von einer rasch entwickelten Vegetation her. Das merkwürdigste aber sind
jedenfalls die schon erwähnten Kanäle, von denen sich einige längs einer
Linie ohne jede Unregelmäßigkeit über den vierten Teil des
Planetenumfangs erstrecken. Niemals endet ein Kanal blind, sondern es
stehen alle untereinander oder mit dem freien Meer oder größeren Seen in
Verbindung. Zuweilen wird ein Kanal für längere oder kürzere Zeit
unsichtbar, zu anderen Zeiten kann er das Aussehen eines breiten,
verwaschenen Streifens annehmen. Die seltsamste Veränderung der Kanäle
besteht aber in deren Verdoppelung, die sich zuweilen in wenigen Tagen,
vielleicht Stunden nach einem Umformungsprozeß vollzieht, dessen
Einzelheiten uns noch nicht bekannt sind. Statt der einen ursprünglichen
laufen nun zwei dunkle Linien nebeneinander her (s. Abbildung 65).
Können wir schon die Form der schmalen, langen, schnurgeraden Kanäle
unseren irdischen Erfahrungen schwer anpassen, so läßt uns unsere
Phantasie hinsichtlich der Verdoppelung der Kanäle vollends im Stiche
und wir können uns keine auch nur entfernt befriedigende Vorstellung
über das Wesen und die Bedeutung dieser rätselhaften Erscheinung machen
Außer den gelben und grauen, ihre Gestaltung stets beibehaltenden
Stellen bemerkt man auf dem Mars auch völlig weiße Gebiete, die aber nur
an den Polen von längerer Dauer sind. Die Veränderungen in der
Ausdehnung dieser weißen Flächen stehen in bestimmter Beziehung zu der
in der betreffenden Gegend jeweilig herrschenden Jahreszeit. Diese
letztere können wir genau ermitteln, da die hierauf bezüglichen
Verhältnisse, Lage des Äquators und der Drehungsachse und die
Umschwungsdauer für den Mars bekannt sind. Auf der nördlichen Halbkugel
herrscht ein milder, kurzer, auf der südlichen ein langer, sehr strenger
Winter. Ganz ebenso wie unsere irdischen Polarkalotten wachsen die
weißen Polarflecke des Mars zur Winterszeit, schmelzen dagegen in der
wannen Jahreszeit stark ab. Die nördliche Polarkappe scheint zentrisch
zum Marspol zu liegen, die südliche ist mit ihrem Mittelpunkt etwa 5,4°
oder 340 km vom Südpol entfernt. In der Zeit des Minimums, 3—6 Monate
nach dem Sommersolstiz (dem längsten Tag) ist der Südpol selbst eisfrei.
Zeitweilige Schneefelder finden sich auch entfernter von den Polen,
selbst bis zum Äquator hin, und es wird angegeben, daß sich solche
weiße, unter dem Einfluß der Sonnenbestrahlung meist bald verschwindende
Felder dann einstellen, wenn vorher Wolken und Nebelbildungen über dem
betreffenden Teil der Marsfläche gelagert waren. Wenn wir nun noch
bedenken, daß das Spektroskop in der Marsatmosphäre reichlichen
Wasserdampf, das Teleskop Wolken- und Nebelbildungen nachweist, werden
wir nicht umhin können, den Schluß, daß auf dem Mars auch Meere
vorhanden sein und diese mit den eisengrauen Stellen der Marsoberfläche
zusammenfallen müssen, als wohl begründet anzusehen.
Diesen in die Augen springenden Analogien mit den irdischen
Verhältnissen stehen bemerkenswerte Abweichungen gegenüber. Daß die
großen Kontinente der Erde am Mars durch zahlreiche gedrängte Inseln
ersetzt werden und das Meer eine verhältnismäßig geringe Fläche
einnimmt, wurde schon bemerkt. Es ist noch hinzuzufügen, daß man wegen
der oben erwähnten Untiefen und der großen Veränderlichkeit des
Aussehens des Meeres demselben nur eine geringe Tiefe zuschreibt, und
noch weitere Differenzen ergeben sich, wenn wir das Relief
berücksichtigen: nirgends finden sich Spuren jener energisch
hervortretenden Linien, welche die Erde der Anwesenheit ihrer großen
Kettengebirge verdankt. Vor allem aber erregt unsere Verwunderung die
zuerst von Schiaparelli beobachtete und von den Astronomen der Lick-Sternwarte
[*4]
bestätigte Fülle der topographischen Veränderungen im Festen und
Flüssigen, die sich auf der Marsoberfläche alljährlich und oft in
rascher Folge vollziehen, und für welche wir uns auf der Erde vergeblich
nach einem Vergleichspunkte umsehen.
Der Mars als Lebensraum:
Ehe wir die Betrachtung des Mars verlassen, drängt sich uns noch eine
Frage auf. Wir sehen auf diesem Planeten Wasser und Land, eine
Atmosphäre und klimatische Verhältnisse, ganz ähnlich den irdischen:
existiert nun dort organisches Leben, grünt frischer Pflanzenwuchs, und
regt sich eine tierische Bevölkerung auf dem Mars? Nach dem soeben
Gesagten ist es sehr wahrscheinlich, daß die Möglichkeit hierfür gegeben
ist; ob aber Organismen wirklich vorhanden sind, dafür hat die
Wissenschaft keine bestimmte Antwort. Es widerstrebt uns allerdings,
einen Weltkörper, der für die Aufnahme von Bewohnern geeignet ist, für
wüst und öde halten zu sollen. Wer die Entstehung des Lebens der
direkten Wirkung eines Schöpfers zuschreibt, wird sich nicht denken
können, daß dieser eine Wohnstätte bereite, ohne sie zu bevölkern; wer
die Entstehung der Organismen als Produkt selbständiger Urzeugung
betrachtet, wird nicht verstehen können, warum das Zusammenwirken
derselben Stoffe und Kräfte auf dem Mars nicht dieselbe Wirkung gehabt
haben sollte wie auf der Erde. Wir werden es daher als sehr
wahrscheinlich ansehen, daß unser Nachbarplanet bewohnt sei; einen
Beweis dafür haben wir aber nicht. Dagegen scheint uns die Annahme etwas
gewagt, daß auch die Entwickelung der Organismen mit derjenigen der Erde
so weit übereinstimme, daß man von Tieren und Pflanzen sprechen kann; es
ist im Gegenteil möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß dieselben wegen
einer ganz eigentümlichen Ausbildung in keines unserer Reiche
einzureihen sind. Wenn man sich vollends damit beschäftigt, welche
geistigen Fähigkeiten die mutmaßlichen Menschen des Mars besitzen, unter
welchen Verhältnissen und sozialen Einrichtungen sie leben, wie das wohl
von manchen Seiten geschehen ist, so hören derartige Phantasien auf,
wissenschaftliche Beachtung zu verdienen; sie sind ein artiges Spiel,
das für Jules Verne einen dankbaren Romanstoff liefern mag, aber nicht
mehr.
Die Bewohnbarkeit im Allgemeinen:
Beiläufig sei hier noch die Frage nach der Bewohnbarkeit anderer
Weltkörper kurz erwähnt; es ist dies ein Problem, welches sich
komplizierter darstellt, als es auf den ersten Blick erscheint. Auf der
Erde ist das Leben an das Vorkommen gewisser sehr zusammengesetzter
Verbindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff
etc. gebunden, vornehmlich an die sogenannten Eiweißstoffe. Diese haben
fast alle die Eigentümlichkeit, bei einer Wärme von 70°C., also noch
ziemlich weit unter der Siedehitze des Wassers, zu gerinnen; es kann
also in der Regel kein Leben existieren, wenn die Temperatur höher ist,
obschon einzelne niedere Tiere bei noch etwas größerer Wärme fortkommen
sollen; ebenso wenig sind die Lebensbedingungen gegeben, wenn die
Temperatur bleibend unter dem Gefrierpunkt verharrt. In dem Ungeheuern
Abstand zwischen der eisigen Kälte des Weltraumes und der furchtbaren
Glut der Sonne und der Sterne ist also nur ein verschwindend kleiner
Spielraum, innerhalb dessen organisches Leben in unserem Sinne möglich
ist. Außerdem müssen Kohlensäure, Wasser, Sauerstoff, Stickstoff in
genügender Menge und in gewissen Verhältnissen vorhanden sein; kurzum,
es bedarf des Zusammentreffens überaus vieler Bedingungen. Alle
Fixsterne mit eigenem Licht sind wegen ihrer hohen Temperatur von
vornherein ausgeschlossen, ebenso die Nebelflecke, während die Kometen
außer den Zeiten ihrer Sonnennähe viel zu wenig Wärme erhalten. Unter
allen uns sichtbaren Himmelskörpern können also nur die Planeten
Organismen enthalten, unter ihnen haben aber wohl Jupiter, Saturn,
Uranus und Neptun eine zu hohe eigene Temperatur; die Asteroiden und
Monde haben teils keine oder nur Spuren einer Atmosphäre, teils sind sie
zu weit von der Sonne entfernt, um von ihr die erforderliche Wärmemenge
zu erhalten. Für Mars und vermutlich auch für Venus, die von der Sonne
etwa doppelt soviel Wärme erhält wie die Erde, dürfen wir die
Möglichkeit der Existenz von Organismen annehmen, während auf dem Merkur
nur kleine Teile der Oberfläche den Bedingungen der Bewohnbarkeit
entsprechen dürften.
Unter der Ungeheuern Menge der uns sichtbaren Himmelskörper sind es also
nur zwei, höchstens drei, welche möglicherweise organisches Leben, wie
wir es auf der Erde kennen, auf ihrer Oberfläche beherbergen. Da aber
vermutlich auch die Fixsterne zum großen Teil von Planeten umgeben sind,
so ist es sehr wohl möglich, daß sich unter diesen eine Menge von
Körpern findet, welche dieselben Bedingungen bieten. Wir haben bisher
angenommen, daß die Existenz des Lebens an das Vorhandensein von
Eiweißstoffen gebunden sei, und haben auch keinen positiven
Anhaltspunkt, davon abzugehen; immerhin aber wäre die Hypothese nicht
absurd, daß unter uns unbekannten Temperaturverhältnissen andere
Grundstoffe dem Eiweiß analoge Verbindungen bilden, welche das Substrat
für verwickelte chemische und physikalische Prozesse abgeben könnten,
jenen ähnlich, die wir an Tieren und Pflanzen beobachten und als „Leben"
bezeichnen. Wiewohl eine solche Vermutung nicht in den Bereich der
Unmöglichkeit gehört, kann sie doch auch keine Grundlage für weitere
Schlüsse abgeben.
[Ende p. 84 / OCR-p.107]
Geschichte der Geowissenschaften
Allgemeine Geologie
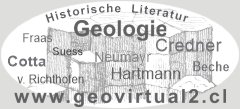
español - deutsch
---
Das Universum und Sonnensystem
Olbersches Paradox (Petzholdt, 1840)
Sonnensystems (Petzholdt, 1840)
Die Sonne (Walther, 1908)
Exzentrizität Erdumlaufbahn (Kayser,
1912)
●
Die Gestirne, der Mars (Neumayr 1897)
●
Hemisphären des Mars (Neumayer, 1897)
●
Verdoppelung der Marskanäle (Neumayr, 1897)
Mond-Karte (Schoedler, 1863)
Ringberg, Mond-Krater (Walther,
1908)
Ringkrater,
ebenen Mond (Walther 1908)
Schnitt durch Mondkrater (Kayser 1912)
Oberfläche Mondes (Kayser, 1912)
Meteorit im Anschliff (Fritsch, 1888)
Pallasit, Meteorit (Neumayr & Uhlig, 1897)
Meteorit von Kakova (Neumayr, 1897)
Meteorit (Walther, 1908)
Meteorit, Chondrit (Kayser, 1912)
Meteorit, beidseitig (Kayser, 1912)
Widmanstätten´sche Linien (Kayser,
1912)
Moldavite (Kayser, 1912)
Biografien
der Autoren
M.Neumayr
/ V.Uhlig (1897)
![]()
Neumayr & Uhlig (1897) in der OCR-Version, korrigiert mit Anmerkungen im
Download-Zentrum
Apuntes Geología General
Das Universum - endlich - unbegrenzt
Universum in Expansion
Chemie des Universums
Animation: Impakt!
![]()
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte Allgemeine Geologie
Geschichte Paläontologie
Geschichte der Lagerstättenkunde
Inhalt
Geschichte der Tektonik
Inhalt Bergbau-Geschichte
Biografien
der Autoren
Wörterbuch, Begriffe
Download Zentrum

