Inhalt der Seite:
Abbildung
Bild infos
Erläuterungen
Text
- - -
Seite +
Inhalt
mehr geovirtual
Fritsch (1888):
Geologie
7. Hebungen: Einführung
7.1.Fossilien auf dem Festlande
7.2. Geodynamik, Meeresräume
7.3. Geo-Tektonische Theorien
7.4. Erdkern als Ursache
7.5. Kontraktions-Theorie
7.6. Ursachen der Erdwärme
7.6.1: Chemische Vorgänge
7.6.2 Die Schwerkraft
7.7. Plastische Verformung
7.8. Kritik und Diskussion
7.9. Plastisches Verhalten
7.10. Direkter Nachweis
Foto/Scan - Digital bearbeitet: (W. Griem, 2019);
Fritsch, K. (1888) - Abbildung 94, Seite 362; Original-Größe 7 X 9 cm.
Titel: Das Serapeum bei Pozzuoli nach einer Photographie. Die 3 noch
aufrechten, 12,28 m langen Marmorsäulen sin zwischen 3,66 und 6,44 Höhe
von marinen Bohrmuscheln (Lithodomen) zerfressen.
Fritsch, K. (1888): Allgemeine Geologie. - 500 Seiten 102 Abbildungen,
Verlag J. Engelhorn Stuttgart.
[Sammlung W..Griem]
Die Abbildungen wurden mit einem HP
Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo
Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der
Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der
Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).
Die Texte wurden mit einer Pentax
Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur
OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in
ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version
14.
Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es
wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W. Griem, 2020).
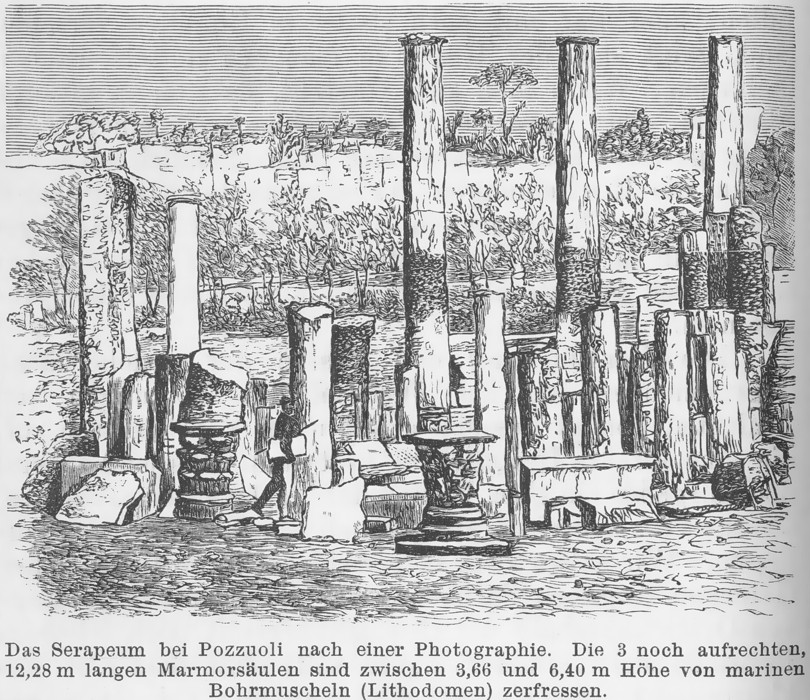
Informationen
Karl von Fritsch (1888): Die Säulen von Pozzuoli - dürfen
natürlich nicht fehlen. Sie beweisen Hebungen der Erdkruste - die
damalige Kontraktions-Hypothese konnte natürlich Senkungen besser
erklären.
Fritsch diskutiert sehr ausführlich die tektonischen Bewegungen der
Erdkruste, und erläutert die möglichen Hypothesen, aber auch die
Limitationen damaliger wissenschaftlicher Argumentationen.
Das Serapeum bei Pozzuoli nach einer Photographie.
Die 3 noch aufrechten, 12,28 m langen Marmorsäulen sind zwischen 3,66
und 6,40 m Höhe von marinen Bohrmuscheln (Lithodomen) zerfressen.
Original Text von
Fritsch 1888; p. 348
7. Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche.
Kommen bei den eben besprochenen Erosionswirkungen Verschiebungen
einzelner Teile der Erdoberfläche meist auf eng begrenztem Raume vor, so
sehen wir bei der Betrachtung des Gebirgsbaues und bei dem näheren
Studium des Materials, aus welchem unsere Erdrinde zusammengesetzt ist,
die Spuren sehr viel größerer Bewegungen, die auf ungleich größere Räume
sich ausdehnen. Wir verweisen in Bezug auf die Anordnung des Materials
auf den geotektonischen Abschnitt, in welchem der Bau mancher Partieen
unserer Erdrinde in seinen Grundzügen dargestellt wurde. Steil
aufgerichtet stehende, ursprünglich aber horizontal abgelagerte
Schichten, auch Verwerfungen, welche die Teile ursprünglich
zusammengehöriger Gesteinskörper auseinandergerissen haben, sind danach
allgemein verbreitet.
1.Fossilien auf dem Festlande:
Im späteren Abschnitte, der die historische Geologie behandelt, wird
besprochen werden, dass an den meisten Stellen der Erdoberfläche
Reste von Meerestieren so häufig gefunden werden, dass man eine frühere
Meeresbedeckung mit Recht überall anzunehmen hat. Es gibt nur
wenige Gegenden, für welche man zweifelhaft sein könnte, ob dort jemals
Meeresgrund gewesen wäre. Fasst man den Bau größerer Landschaften ins
Auge, so ergibt sich unter anderem, dass die großen granitischen und
Gneis-gebirge, wie wir sie in Brasilien, im südlichen Teile Indiens, in
Skandinavien etc. vor uns sehen, und dass auch die kleineren
granitischen Massen, z. B. die des bayerisch-böhmischen Gebirges selbst
in dem Falle vom Meer später noch zugedeckt gewesen sein müssen, wenn
ihre ursprüngliche Bildung nicht, wie wir für wahrscheinlich erklärt
haben, eine marine war, bei welcher die Diagenese des Absatzmaterials
die kristallinische Gestaltung vorzugsweise erzeugte. Das
bayerisch-böhmische Gebirge z. B. muss überschritten worden sein von
demjenigen Meere, aus welchem sich die Kreideschichten von Regensburg
einerseits, und von dem inneren böhmischen Becken andererseits abgesetzt
haben. Die kleinen Reste von Jurakalk, welche wir aus dem Innern
Böhmens, bezüglich von der, sächsisch-böhmischen Grenze kennen,
erweisen, insbesondere bei der genaueren Untersuchung ihrer Fauna, dass
zur Jurazeit das Meer über die heutige Gebirgsscheide hinwegging,
vielleicht das ganze eigentliche Erzgebirge bedeckte und den fränkischen
mit dem schlesischen und polnischen Jura in Verknüpfung brachte.
Gleiches lässt sich aus der Betrachtung der Gesteine und der darin
enthaltenen Fossilien für die großen, skandinavischen Granit- und Gneis
Massen, sowie für die brasilianischen beweisen.
2. Die Geodynamik der Meeresräume:
Haben wir von dem Raume, den jetzt das Festland einnimmt, keine einzige
Stelle, welche nicht einstmals vom Meere bedeckt sein musste, so ist der
korrelate Schluss der, dass auch jede Stelle, welche jetzt Meeresboden
ist, im Laufe der Zeit einmal oder wiederholt Festland gewesen ist. In
der Tat können wir von zahlreichen Meeresstellen den direkten Nachweis
führen, dass sie nicht zu allen Zeiten vom Meere bedeckt sein konnten.
Wohl wissen wir, dass ein Meer niemals an allen Stellen seines
Auftretens Schichten hinterlässt, dass Zerstörung des Absatzmaterials
durch den chemischen Angriff des Meerwassers auf das Gestein oder auf
das werdende Sediment es mit sich bringt, dass im tiefen Ozean ältere
Gebilde unmittelbar an den Grund des Meeres treten. Aber dennoch ist
mit
voller Sicherheit nachzuweisen, dass in gewissen, jetzt vom Meere
bedeckten Teilen Zerstörungen stattgefunden haben, wie sie nur oberhalb
des Meeresspiegels eintreten können. Das zeigt sich bei der genaueren
Untersuchung des Baues verschiedener Inselgruppen, welche zum Teil weit
innerhalb des Meeres gelegen sind, in der Mitte ozeanischer Becken. Wir
erinnern in dieser Beziehung sowohl an die Verhältnisse der Inseln und
Inselgruppen des Atlantischen Ozeans als an die wohlbekannten Gebiete im
Stillen Ozean, z. B. an Neuseeland.
Die Lehre von der Ursprünglichkeit der jetzigen Ozeane
wird den eben gegebenen Darlegungen gegenüber von einer nicht geringen
Anzahl von Forschern behauptet. Wunderlich erweise werden aber Momente
dafür geltend gemacht, die geradezu für die gegenteilige Ansicht
sprechen. Wenn irgendwo aus dem Meere granitische Inseln auftauchen, so
sollen diese den Nachweis liefern, dass dort von Anfang an Meeresgrund
gewesen sei.
Müsste denn nicht an Stellen, die ursprünglich Meeresgrund waren, eine
mächtige Reihe der jüngeren Meeresgebilde zur Ablagerung gekommen sein?
Aus dem Meere auftauchende Granitinseln sind also im Gegenteil ein
deutlicher Beweis dafür, dass, was auf dem Granit früher gelegen hat,
hinweggeführt worden ist, und diese Hinwegführung hängt wahrscheinlich
hauptsächlich mit den gewaltigen Erosionen zusammen, welche durch die
atmosphärischen Niederschläge auf Festlandpartien ausgeübt werden.
Ebenso hat man, um die frühere, beständige Meeresbedeckung zu beweisen,
betont, dass auf Inselgruppen in der Nähe der Sundainseln zwar
paläozoische Schichten und namentlich Kohlenkalk vorkommen, dann aber
nur noch tertiäre Bildungen. Jene Lücke der Ablagerungen, das Fehlen der
mesozoischen Schichtenreihen, spricht im Gegenteil dafür, dass jene
Gebilde in der Zwischenzeit Festland waren, oder wenigstens während
eines Zeitraumes als solches bestanden. Nun ist allerdings nach dem
gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse nicht in Abrede zu stellen, dass
ein Steigen oder Sinken des Meeresspiegels, also die Überdeckung
irgendeines Erdstriches mit dem Ozean, keineswegs in allen Fällen eine
Bewegung derselben Stelle der Erdoberfläche beweist. Wir wissen, dass
durch die Anziehung des Wassers nach benachbarten Festlandsmassen hin
oder selbst durch Aufschüttungen, die auf dem Meeresgründe erfolgen, der
Spiegel des Ozeans erhöht werden muss. Die Berechnungen, nach welchen
verschiedene Stellen des Meeresspiegels 1000, ja sogar 1400 m
Höhendifferenz zeigen, sind, wenn wir die wirkliche Entfernung vom
Erdmittelpunkte dabei zu Grunde legen, für erwiesen zu halten. Wir
dürfen somit eine Meeresbedeckung größerer Räume, die jetzt Festland
sind, und eine Freilegung eines Teiles des Meeresbodens durchaus
nicht in allen Fällen für Beweise von Hebung und Senkung ansehen,
zumal da die Erdfeste durch Meteoriten stets wächst.
3. Erdkruste und Theorien der geotektonischen Bewegungen:
Es sind indes andere Verhältnisse, die in den geo-tektonischen
Beobachtungen zur Geltung kommen, die uns dazu nötigen, auf- und abwärts
gerichtete Bewegungen größerer Teile der festen Erdoberfläche
anzunehmen, und solche Bewegungen müssen ja auch ein Kommen oder Gehen
der Meeresbedeckung, bezüglich eine Stauung von Binnenwässern oder ein
Abfließen der letzteren in erheblichstem Masse bewirken. Dass jede
Schichtenbildung ursprünglich nur in nahezu horizontaler Lage erfolgen
konnte, liegt in der Natur der Sache, überall also, wo Schichten
senkrecht stehen oder übergekippt sind und ihr Liegendes zu scheinbar
Hangendem haben, hat sich die feste Erdrinde bewegt, überall, wo
Zerreißungen der Schichten die gleichzeitig und gleichartig abgesetzten
Materialien in verschiedenes Niveau gebracht haben, sind ebenfalls
solche Veränderungen eingetreten. Es ist, wie bei den meisten Naturerscheinungen, ein Bestreben der Forscher, eine einzige Ursache für
die Verschiebungen der Erdrindenmassen aufzufinden, eine
Generalhypothese aufzustellen, welche alle Hebungen und Senkungen
erklären soll, vielfach zur Geltung gekommen. Es ist ein solches
Bestreben psychologisch sehr begründet, denn der Mensch generalisiert
nur allzu gern, und wer eine Ursache ergründet hat, die große Wirkungen
hervorruft, versucht es gern, dieser Ursache auch noch weitere Wirkungen
zuzuschreiben. Es sind daher eine Reihe von verschiedenen Theorien über
die Bewegungen der Erdoberfläche aufgestellt worden. Diese Theorien
zerfallen vorzugsweise in zwei Reihen, in jene, welche den Hauptsitz der
Bewegungen in dem tiefsten Erdinnern annehmen wollen, und in jene,
welche den äußeren Teilen der Erdrinde selbst dabei eine größere Rolle
zuschreiben. An die letzteren Theorien reihen sich diejenigen Meinungen
und Hypothesen an, welche fast ausschließlich den Wechsel in die
Bewegungen des Wassers zu verlegen bemüht sind und Schwankungen des
Seespiegels entweder als periodische und säkulare, oder als mehr
plötzliche annehmen.
4. Erdkern als Ursache der vertikalen Kräfte:
Jene Theorien, welche in dem innersten Kerne der Erde vorzugsweise die
Ursache der Erscheinungen suchen, haben selbst wieder nach zwei
Richtungen hin, sich voneinander getrennt. Eine Reihe früherer Forscher
dachte vorzugsweise an Kräfte, die in radialer Richtung vom Erdkern nach
außen, oder von außen nach dem Erdmittelpunkte gerichtet waren. Für sie
setzte jede Hebung eine Ursache voraus, welche senkrecht unter den davon
betroffenen Teilen der Erdoberfläche sich befand. Während man anfangs
die Schwierigkeit, welche in dem Vorhandensein übergekippter Schichten
liegt, unbeachtet ließ, hat sich bald herausgestellt, dass solche
Erscheinungen an zu zahlreichen Punkten der Erdoberfläche auftreten, um
überhaupt den Gedanken an die vorwaltende Tätigkeit radial wirkender
Kräfte noch zu gestatten.
5. Kontraktions-Theorie und tangentiale Kräfte:
Eine zweite Reihe von Forschern sieht allerdings in dem Erdinnern und in
den uns vollständig unbekannten Kernmassen desselben die vorherrschende
Ursache der Oberflächenbewegungen, aber es werden im wesentlichen
tangential wirkende Kräfte angenommen. Diese Forscher glauben an
eine ungeheure Wärme des Erdinnern und an eine sehr bedeutende
Dilatation des Stoffes in demselben und suchen in dem Drucke,
den die äußere Rinde, die sich dem inneren Kerne anzuschmiegen suche,
ausübt, bei zunehmender Erkaltung der gesamten inneren Masse die
Veranlassung zu den Bewegungen der äußeren Rinde.
Diese Theorie ist eine Folge der auf physikalische und astronomische,
nicht aber auf geologische Gründe gestützten Vorstellung von der
ursprünglich gasförmigen Beschaffenheit des ganzen Erdballs. Es
liegt auf der Hand, dass Kontraktionen des Erdinnern in
dem Falle eine sehr bedeutende Kraftwirkung äußern müssen, wenn die
äußere Rinde stets gezwungen bleibt, eng anzuschließen an die inneren,
erkaltenden Massen. Auf der anderen Seite ist in den Verhältnissen, die
wir von sehr zahlreichen Naturerscheinungen kennen, durchaus nicht die
Notwendigkeit eines solchen engen Anschließens an den sich
zusammenziehenden Kern erkennbar. Betrachten wir die sehr häufige
Bläschenform, welche eine sich kontrahierende Wassermasse beim Übergange
aus dem gasförmigen in den tropfbar - flüssigen Zustand annimmt,
beobachten wir in unseren vulkanischen Gesteinen die unendlich häufige
Ausbildung hohler, kugelförmiger Konkretionen, der sogenannten
Lithophysen, und fassen wir eine Anzahl ähnlicher Erscheinungen in den
Natur Vorgängen, wie in den vom Menschen angeregten, chemischen
Synthesen zusammen, so erkennen wir, dass in sehr zahlreichen Fällen ein
Bestreben äußerer Rinde, dem sich kontrahierenden Kerne sich
anzuschließen, nicht in dem Masse stattfindet, wie es jene Theorie als
allgemein voraussetzt.
Eine Erstarrungsrinde der Erde würde man also sich leicht als eine
Schale denken können, die in sich selbst Zusammenhalt genug besäße, der
Kontraktion der inneren Masse nicht zu folgen. Nehmen wir dagegen an,
dass die Kontraktion des Kernes den innigen Anschluss der Rinde nach
sich ziehe, so werden allerdings die tangentialen Wirkungen in den
verschiedenen Formen auftreten können, in welchen wir die Erscheinungen
beobachten.
Wir werden übrigens auch die tangentialen Spannungen, Stauungen und
Pressungen nach der Weise der zweiten Reihe von Forschern erklären
können, welche auf das unbekannte Material des Erdinnern nicht
zurückgehen, sondern lediglich die Verhältnisse der äußeren Erdrinde
selbst in Betracht ziehen. Diese äußere Erdrinde kennen wir als einen
Körper, der zwar in seiner Äußersten Schale von der Sonne direkt gewärmt
wird, der aber doch im allgemeinen von außen nach innen an Wärme derart
zunimmt, dass die inneren Teile der Erdkruste wärmere sind, als irgend
ein Teil des sonnenbestrahlten Bodens der Tropenzonen. Überall
ist die Zunahme der Wärme nach unten hin nachgewiesen, und ein
sehr erheblicher Teil der Wärme des Innern wird übergeführt auf die
Atmosphäre. Wir müssen also annehmen, dass die Erdrinde selbst
stets im Erkalten begriffen ist, weil sie Wärme nach außen abgibt.
Diese Wärmeabgabe ist teils eine konstante und gleichbleibende, teils
eine örtlich und zeitlich gesteigerte. Am meisten Wärme gibt das
Erdinnere in denjenigen Landschaften an die Luft ab, wo heißes oder
wenigstens warmes Wasser an die Erdoberfläche dringt. Bei besonderen
Ereignissen, die zeitweise eintreten, bei vulkanischen Erscheinungen
werden mit einem Male Tausende von Kalorien nach außen abgegeben.
Zeiten, in welchen besonders zahlreiche vulkanische Ausbrüche
statthaben, sind also Perioden einer besonders starken Wärmeabgabe der
Erdrinde, und da die Stoffe, aus denen die letztere besteht, samt und
sonders beim Erkalten sich zusammenziehen, müssen solche Zeiten
besonders zahlreicher Eruptionen auch als Perioden besonders kräftiger
Kontraktion der Erdrinde gelten. Kontraktion der Erdrinde muss dahin
führen, dass die Massen derselben sich stauen und drängen und örtlich
zusammenschieben, daher auch spalten und reißen. Diese Bewegungen selbst
müssen örtlich wieder innerhalb der Erdrinde Wärme erzeugen, die dann
wieder nach außen abgegeben werden kann, welche Wärme sich bei der
geringen Leitungsfähigkeit der Gesteine bedeutend summieren muss, wenn
im Laufe der Zeiten neue, als Wärme fühlbare Bewegungen zu den noch
nicht verlorenen und noch nicht abgegebenen, älteren Wärmeschwingungen
hinzutreten.
6. Ursachen der Erdwärme:
Was die Ursache der Erwärmung anbetrifft, so ist neben den mechanischen
Ursachen auch ein großes Gewicht auf die chemischen zu legen. Namentlich
seit in den letzten Jahren die Thermochemie sich eingehender mit den
Fragen über die bei chemischen Neubildungen von Stoffen erzeugte Wärme
beschäftigt, ist es klar, dass jene Vorgänge, deren Spuren wir auf
Schritt und Tritt bei der Gesteinsuntersuchung wahrnehmen, die
Ausscheidung und Ausfällung von Mineralien, die Aufnahme von Wasser in
chemische Verbindungen, die Oxydation von manchen Eisen- und
Manganmineralien etc., recht erhebliche Wärmemengen schaffen muss.
6.1: Chemische Vorgänge und Ausdehnung
Was diese Vorgänge nun im einzelnen anbetrifft, so ist die Folge von
zahlreichen jener chemischen Wirkungen, namentlich der Oxydation und
Hydratisierung, eine Vergrößerung des Volumens und damit eine
Druckwirkung auf die umgebenden Massen, welcher Druck selbst wieder
Wärme in denselben erzeugen muss. Die Erwärmung von Materialien, wenn
sie auch nur wenige Grade beträgt, muss doch auf das Volumen der
Gesteinsmassen einen erheblichen Einfluss üben. Wir sind zwar wenig
unterrichtet über die Volumenausdehnung, welche die einzelnen Mineralien
und Gesteine bei der Erwärmung erfahren, aber selbst wenn die sehr
geringe Volumenausdehnung des Glases zu Grunde gelegt wird, ergeben sich
für einzelne Gesteinsschichten sehr erhebliche Zahlen. Schichten von
8—10 m Stärke, welche auf dem Raume von einigen Quadratkilometern sich
ausbilden, also noch zu den kleineren gehören, dehnen sich bei der
Erwärmung etwa von der Temperatur +2 °, die sie bei ihrer Bildung auf
dem Meeresboden haben, auf + 10 °, die sie erreichen (wenn die
gewöhnlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt werden), sobald die Masse von
240 m weiteren Materials überdeckt ist, sehr erheblich aus. Nun werden
in der Erde und innerhalb der Erdrinde auch sehr häufig ganz andere
Ausdehnungsverhältnisse beobachtet. Bei der vulkanischen Tätigkeit
füllen sich Spalten des Gesteines mit flüssiger Lava, welche 1000° und
mehr warm ist. Diese Lava breitet sich gewöhnlich an der Oberfläche der
Erde oberhalb der Spalten noch etwas aus. Eine Lavamasse samt den
Spalten füllenden Gängen wirkt bei ihrer Erkaltung notwendigerweise in
ähnlicher Art, wie die glühend gemachten Eisenstangen, durch welche die
Architekten rissig gewordene Mauern zusammenziehen. Jene Erwärmungen
gewisser Stellen der Erdoberfläche durch die vulkanische Tätigkeit und
die Erkaltung bei dem etwaigen Erlöschen der vulkanischen Kräfte für
jene Orte müssen sehr erhebliche Kraftwirkungen äußern. Rechnen wir
hinzu, dass eine sehr große Reihe von mechanischen Kräften auch dadurch
in Gang gesetzt wird, dass die Gesteine, wenn sie vom Wasser der Quellen
u. s. w. durchzogen werden, einer chemischen Veränderung unterliegen,
zum Teil aufgelöst werden, und dass der Massendruck gewisse,
ursprünglich feste Gesteinsmassen, wenn sie teilweise aufgelöst worden
sind, zusammenzupressen in der Lage ist, wodurch die Bewegung von
anderen benachbarten Massen gleichzeitig angeregt wird, so haben wir in
der Rinde der Erde selbst, ganz abgesehen von der zweifelhaften
Zusammensetzung des Erdkernes, Ursachen zu den gewaltigsten Bewegungen,
die wir als Hebungen und Senkungen aufzufassen gewohnt sind.
6.2 Die Schwerkraft als vertikale Komponente:
Soweit die Schwerkraft bei den genannten Bewegungen wesentlich mitwirkt,
wird die vertikale Komponente der Bewegungen eine sehr große Bedeutung
erlangen. Zur Geltung kommt diese vertikale Komponente aber in
vielen Fällen weniger, als die horizontale. Ähnlich wie ein
fließender Gletscher durch die Schwerkraft vorwärts getrieben wird, so
werden auch plastische Gesteinsmassen (lose Sande, weiche Tone und
dergleichen) in eine Art von gleitender Bewegung versetzt, mögen sie
innerhalb der Erde, oder an ihrer äußeren Oberfläche sich befinden. Man
beobachtet in manchen Fällen die Spuren dieser Bewegungen am
Gesteinsmaterial sehr deutlich, und sogenannte Quetschungserscheinungen
der weicheren Gebirgsarten, welche von bedeutenderen anderen Massen
überlagert sind, gehören zu den häufigsten Wahrnehmungen, die wir machen
können. Wirken sich, wie es z. B. bei einer Muldenstellung der Schichten
sehr natürlich ist, die Druckkräfte gegeneinander gleitender Massen
entgegen, so wird in der Mitte der Mulde eine besonders starke Stauung
statthaben, und diese Stauung kann unter Umständen in der Richtung der
Muldenlinie eine neue Auffaltung zur Folge haben, wenn das
Schichtenmaterial nachgiebig genug ist, um eine solche Faltung zu
gestatten. In anderen Fällen müssen die Spannungen zur Bildung von
Zerreißungen führen, und diese Zerreißungen selbst erzeugen dann neue
Verschiebungen nach anderen Richtungen hin.
7. Plastische Verformung, Kohäsion und metamorphe Vorgänge
Bei den Vorgängen, welche innerhalb der Erde stattfinden, kommt nun sehr
wesentlich in Betracht die Kohäsion der Massen einerseits und deren
Beweglichkeit auf der anderen Seite. Die Kohäsion gleichartiger Teile
wird in der Regel als eine sehr bedeutende erkannt, wie sich auch
experimentell leicht zeigt.
Wer hätte nicht mit Bewunderung die Faltungen und Verbiegungen von
Schichten in zahlreichen Beispielen solcher Erscheinungen wahrgenommen?
Die Faltung ganzer Schichtenmassen ist einer derjenigen Punkte, dessen
Erklärung uns auf den ersten Anblick sehr schwer erscheint, namentlich
wenn die Faltungen auch solche Massen betroffen haben, die wir als
absolut starr anzusehen gewohnt sind. In vielen Fällen zeigt sich, dass
nebeneinander befindliche Massen von verschiedenem Zusammenhang der
Teile bei solchen Faltungen sich verschieden verhalten haben, dass aber
doch für die nebeneinander vorkommenden Massen im Großen und ganzen die
gleichen Kräfte die gleichen Folgen gehabt haben. Am auffälligsten sind
die Erscheinungen dort, wo Lavaströme harten und scheinbar durchaus
nicht nachgiebigen Materials ganz gleiche Schichtenbeugungen
durchgemacht haben, wie etwaige begleitende weiche Schiefer und
zerreibliche Sandsteine. Betrachtet man solche Verhältnisse genauer, so
sieht man in der Regel, wie die Schiefer etc. in sich selbst durch
Ortsveränderungen kleinster Teilchen gegeneinander verbogen und
umgestaltet worden sind, während die eingelagerten Porphyre, Porphyrite
und dergleichen Gesteine zahlreiche Spalten, oft mit sogenannten
Rutschflächen, zeigen, und also in größere Stücke zerbrochen wurden, die
dann doch gleich einem einheitlichen Ganzen in ähnlicher Weise
verschoben wurden, wie die umgebenden Schiefer *1). Ähnlich wie die
eingeschalteten Laven verhalten sich häufig mächtige Kalksteinbänke, die
zwischen anderen Massen inne liegen. Über die Beweglichkeit und
Biegsamkeit bereits vollständig verfestigter Schichten stehen sich die
Ansichten noch sehr schroff gegenüber. Wer das Experiment selber
ausgeführt. hat, einen Kalkspat-Kristall oder Kalkspat-Spaltungskörper
mit dem Messer derart zu zerschneiden, dass man dabei eine klaffende
Spalte erzeugt, und die Teile in Zwillingsstellung zu einander bringt,
wer ähnliche Beobachtungen auch an anderen Mineralkörpern, z. B. an
Zinkblende gemacht hat und das feste Material mit verhältnismäßig
geringem Drucke in andere Formen gebracht hat, der zweifelt an einer
gewissen Plastizität auch der starren Gesteine nicht. Nur ist fraglich,
ob alle jene Gesteine, die man als im starren Zustande verbogen annimmt,
nicht jene Biegungen noch im weniger erstarrten durchgemacht haben.
Äußerst wahrscheinlich aus vielen Gründen ist, dass die
hochkristallinische Beschaffenheit mancher sehr alten Gebilde, dass die
Zunahme der Kristallinität mit dem geologischen Alter einerseits und mit
den mechanischen Biegungs- und Faltungsvorgängen und Druckerscheinungen
andererseits darauf hinweist, dass die Gesteine zum Teil erst fest und
kristallinisch geworden sind durch wiederholte und langdauernde
Pressungen, denen sie unterworfen wurden.
8. Kritik und Diskussion der Theorie - Das Fehlen von
Informationen:
Von verschiedenen Seiten ist der Versuch gemacht worden, schon jetzt
über die Vorgänge bei der Gestaltung der heutigen Erdoberfläche ein
abschließendes Urteil zu gewinnen. Es sind diese Versuche noch immer mit
einer gewissen Vorsicht aufzunehmen, denn die Geschichte der einzelnen
Gebirge, die selbst erst wieder zu der Geschichte der gesamten
Erdoberfläche sich verbinden muss, ist häufig eine so lange, von so
verschiedenen Momenten beeinflusste, dass der unvollkommene Zustand
unserer jetzigen Kenntnisse vom Bau der Erdoberfläche noch sehr störend
wirkt. Sind wir doch selbst in den von Geologen am längsten
durchforschten Gebieten des mittleren Deutschlands noch immer gewärtig,
dass weitere, neue Entdeckungen folgen, wie sie im letzten Jahrzehnt
sehr vielfach gemacht worden sind. Von großen Gebieten kennen wir kaum
die allerdürftigsten Darstellungen und wissen gewöhnlich nicht genau,
was von Gesteinsmaterial und was von den Erzeugnissen der verschiedenen
Zeiten der Erdgeschichte vorhanden, was absolut fehlend ist. Über die
Zeiten, in welchen die Bildung gewisser wohlbekannter Gebirge begonnen
hat, und über die dabei wirksamen Vorgänge sind sehr verschiedene
Ansichten noch aufgestellt, die einander zum Teil sehr schroff
gegenüberstehen. Die Zeit, welche in Anspruch genommen worden ist für
eine bestimmte Bewegung, ist uns in sehr. zahlreichen Fällen noch wenig
bekannt, und doch ist es ein enormer Unterschied, ob wir uns die
Emporfaltung der Alpen z. B. auf einen einzigen Zeitraum oder auf eine
Reihe von Zeitabschnitten verteilt zu denken haben. Über die liegenden
Falten, die an der Nordseite der schweizerischen Alpen von Baltzer, von
Heim und früher von Arnold Escher von der Linth untersucht worden sind,
sind die Meinungen, wie der Streit Heims mit Vacek gezeigt hat, noch
keineswegs ganz gesichert, und wenn jene liegenden Falten erst stehende
gewesen wären, d. h. wenn im Verlaufe irgend eines geologischen
Zeitraumes das, was jetzt als ein übergeschobenes Gewölbe geschildert
wird, erst einmal sich gebildet hätte als eine vertikale, steile Mulde,
die dann durch spätere Bewegungen seitwärts gedrängt worden wäre, so
würde die Theorie dieser Bewegung eine wesentlich andere sein müssen,
als die bisher dafür aufgestellte. Aus früheren Darstellungen und
Abbildungen in diesem Werke geht hervor, dass die Bruchlosigkeit der
Falten und die gleichzeitige und in einem verhältnismäßig kurzen
Zeitabschnitt erfolgte Gestaltung derselben mit des Verfassers
Beobachtungen nicht harmoniert. Auch ergibt sich aus den Beobachtungen
an sehr zahlreichen Stellen der Erdoberfläche, dass weitaus die meisten
Gesteine nicht ohne Bruch und Zerreißungen einer Verschiebung und
Faltung unterworfen werden. In sehr zahlreichen Kalksteinen, die in der
Nähe von Biegungsstellen auftreten, nimmt man eine beträchtliche Anzahl
von mit Kalkspat erfüllten, also wahrscheinlich eine Zeitlang offen
stehenden Spalten und Trümern von Kalkspat wahr. Es erscheint unter
Umständen ein ganzes, größeres Stück förmlich Breccien artig, wenn
derartige Umstände eingetreten sind.
9. Plastisches Verhalten der Gesteine - speziell alte Granite:
Verbogene Petrefakten sind in sehr zahlreichen
Gesteinen zu finden, die verbogenen Schalen liegen aber nur da
ausgedehnt und in die Länge gezogen, wo eine ursprüngliche Plastizität
des Materials angenommen werden kann, die auch vielen Kalkschlämmen
ursprünglich eigen gewesen ist. Solche Versteinerungen, welche wie die
Belemniten oder wie die Knochen von Wirbeltieren, von vornherein
größere, feste Körper darboten, sind auseinandergespalten, und die
Zwischenräume zwischen den verschobenen Stücken zeigen sich häufig mit
Kalkspat ausgefüllt. Ähnliche Verunstaltungen, wie sie bei den
Belemniten der Alpen vorkommen, sind nicht ganz selten auch im
norddeutschen, subhercynischen Hügellande, und überall lässt sich die
Umformung als eine mit Brüchen erfolgte dartun. Manche Gesteine von
blätteriger Struktur und schieferigem Gefüge zeigen, wenn sie großem
Druck ausgesetzt worden sind, ein Aufblättern der einzelnen Lagen, die
sich gegeneinander verschoben haben, an bestimmten Stellen gerissen
sind, und deren Zwischenräume dann wahrscheinlich, nachdem der Druck
schon längere Zeit gewirkt hatte, mit Kalkspat, mit Quarz oder einem
ähnlichen Mineral ausgefüllt sind, dessen Entstehung auf dem Wege der
Ausscheidung aus Wasser bekannt ist. Es ist nur bei einzelnen Gesteinen
scheinbar eine wirkliche Plastizität vorhanden. Dahin gehören namentlich
die eigentlich körnigen Gebirgsarten, und man kann sich kaum verstellen,
dass ein Granit, welcher als Kern eines Sattels hervortritt, nicht in
sich selbst zusammengeschoben worden sei, obwohl man keine Spalten und
keine Verschiebungen der einzelnen Teile gegeneinander zu bemerken
pflegt. Unter solchen Verhältnissen, zwischen Schichtenmassen, die mit
30—40° einfallen, oder gar mit noch steilerem Einfallen versehen sind,
zeigt sich der Granit in manchen mitteldeutschen Gebirgen. Wenn man sich
vorstellt, dass dieses körnige Material einer gewissen Verschiebbarkeit
seiner Teile fähig gewesen sei, erklären sich wahrscheinlich am
leichtesten die Erscheinungen der sogenannten Granitgänge, welche in das
Nebengestein eingreifen, mit dem Gebirgsgranite in direkter Verknüpfung
zu stehen pflegen, aber sehr selten petrographisch genau mit demselben
Übereinkommen.
10. Visueller, Direkter Nachweis der tektonischen
Bewegungen:
Die Verschiebung der Massen der Erdoberfläche gegeneinander
und der Wechsel der Neigungen von Schichten kommt äußerst selten unter
Verhältnissen vor, die eine direkte Beobachtung gestatten. Bis jetzt
scheint noch nirgends ein ganz bestimmter Nachweis eines solchen,
zu
unseren Lebzeiten stattgefundenen Vorganges vorzuliegen. Wir haben zwar
in verschiedenen mitteldeutschen Gebirgen Angaben darüber, dass die
gegenseitige Lage von Orten innerhalb der Beobachtungszeit noch lebender
Personen sich verändert haben soll, ohne dass eine Erklärung der
Erscheinung, dass man nun von einem bestimmten Dorfe aus ein anderes
erblickt, was früher nicht zu sehen war, durch die Veränderungen im
Waldbestande, in der Kultur, in den Bauwerken etc. gegeben wäre, aber
alle derartigen Beobachtungen beruhen bis jetzt auf mündlichen
Erzählungen, noch nicht auf sorgfältigen Messungen *2). Man kennt eine
Anzahl von Gegenden der Erde, in welchen während der letzten
Jahrhunderte das Niveauverhältnis sich verändert hat, und namentlich an
Seeküsten sind mehrere Punkte bekannt, welche Verschiebungen zeigen.
Eine der berühmtesten Stellen der Art ist das sogenannte
Serapeum in der Nähe von Puzzuoli am Golf von Neapel. Das
Gebäude, von dem gegenwärtig noch drei Säulen aufrecht stehen, während
die übrigen umgestürzt, oder nur noch in Stümpfen erhalten sind, zeigt
in diesen Säulen und den Trümmern von anderen, dass der Spiegel des
Mittelländischen Meeres an dieser Stelle einst wesentlich höher
gestanden hat, und da es durchaus unwahrscheinlich ist, dass man die
kostbare Säulenhalle in tieferem Niveau, als der Meeresspiegel darbot,
errichtet habe, so ist wahrscheinlich ein Sinken und ein späteres
Steigen des Grundes an dieser Stelle umso mehr anzunehmen, als man auch
aus historischen Berichten von der Freilegung eines Teiles des Strandes
vom Wasser und aus älteren historischen Berichten eine Kunde von einer
notwendig gewordenen Erhöhung des Bodens innerhalb des Gebäudes erhalten
hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist hierüber angegeben worden, dass
das Steigen des Bodens stattgefunden zu haben scheint, als in der Nähe
im Mittelalter vulkanische Ausbrüche statt hatten und den Boden in der
Nähe erwärmen mussten, während die Senkung eingetreten zu sein scheint,
seitdem in der Umgebung des Montenuovo eine Erkaltung des Bodens
stattgefunden hat. Die Zeit der tiefsten Einsenkung des Gebäudes soll
zusammenfallen mit der Periode, in welcher die vulkanische Tätigkeit in
jener Gegend überhaupt sehr zurücktrat, oder höchstens der Vesuv eine
bedeutendere Menge von Eruptionen zeigte. Das Aufsteigen wird als ein
verhältnismäßig schnelles angegeben gegen das Jahr 1538 zur Zeit der
Eruption des Montenuovo. Dieses sogenannte Serapeum soll übrigens nach
Angabe einiger Beobachter nicht mit aller Bestimmtheit die Kennzeichen
solcher plötzlichen Verschiebungen an sich tragen, es pflegt jedoch als
ein Beispiel sogenannter säkularer Erhebung in der Literatur aufgeführt
zu werden.
[Ende: p. 363]
*1) Sehr zahlreiche derartige Bewegungsspuren sind in
den vielen Steinbrüchen in der Nähe von Halle, Giebichenstein u. s. w.
leicht erkennbar, besonders in der Nähe der steiler aufgerichteten
Sedimentmassen, wie sie z. B. im Thale von Wittekind sich zeigen.
Ähnliches sieht man auch sehr deutlich im mittleren Thüringen, z. B. bei
Tambach etc.
*2) Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft vom Jahre 1869,
S. 371 und Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Thüringer Waldes vom
Jahre 1884, S. 16.
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte
Tektonik
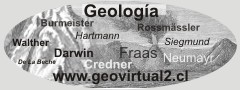
español - deutsch
Tektonische Bewegungen
Text: Bildung Erdkruste (Naumann, 1850)
Senkungen versunkene Wälder (Beche, 1852)
Küstenhebungen (Beche, 1852)
Tektonische Hebungen (Beche, 1852)
Hebungen (Beche, 1852)
Hebungen Englischen Küste (Beche, 1852)
Vertikale Bewegungen
(Roßmäßler, 1863)
Hebung Chile (Darwin, 1876)
Serapis, Hebung (Beudant, 1844)
Ruinen Pozzuoli (Roßmäßler,
1863)
Ruinen Pozzuoli (Siegmund,
1877)
Pozzuoli
(Lippert (1878)
►
Säulen Pozzuoli (Fritsch, 1888)
Ruinen von Pozzuoli (Credner, 1891)
Profil Alpen, Orogenese (Siegmund,
1877)
Prozesse der Gebirgsbildung (Siegmund, 1877)
Ostafrikanischer Graben (Neumayr, 1897)
Biografien
der Autoren
Karl von Fritsch (1888)
Download Zentrum:
Historische Bücher der Geowissenschaften
![]()
Download Zentrum: Fritsch, 1888
Skript Tektonik (span.)
Horst y Graben
Plattentektonik - Karte
![]()
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte Allgemeine Geologie
Geschichte Paläontologie
Geschichte der Lagerstättenkunde
Inhalt
Geschichte der Tektonik
Inhalt Bergbau-Geschichte
Biografien
der Autoren
Wörterbuch, Begriffe
Download Zentrum

