Inhalt der Seite:
Abbildung
Bild infos
Erläuterungen
Text
- - -
Seite +
Inhalt
mehr geovirtual
Roßmäßler (1863)
Geologie
Foto/Scan - Digital Bearbeitet: (W.Griem, 2007, 2019); De: E. A Roßmäßler - "Theorie der Gletscherbildung."; Abbildung 15, Seite 67. Originalgröße der Abbildung: 8 cm X 11 cm.
Roßmäßler, E.A. (1863): Die Geschichte der Erde. -
408, 87 Abbildungen; Verlag Leuckart, Breslau.
[Sammlung W. Griem]
Die Abbildungen wurden mit einem HP
Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo
Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der
Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der
Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).
Die Texte wurden mit einer Pentax
Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur
OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in
ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version
14.
Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es
wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W.Griem, 2020).
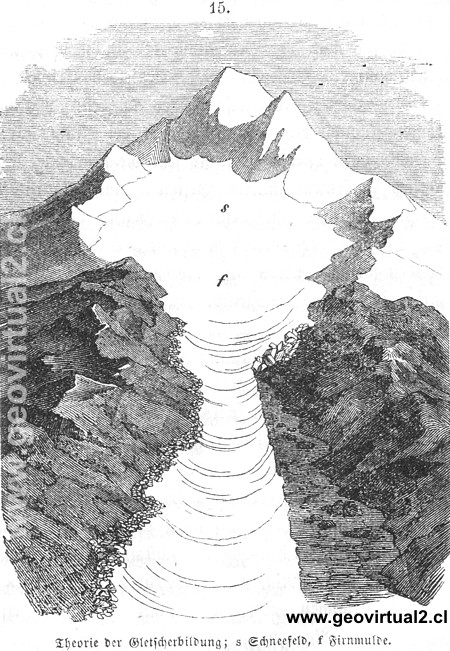
Roßmäßler (1863) diskutiert die Dynamik der Gletscher.
Speziell die Form in der sich das Eis Talabwärts bewegt. Roßmäßler
benutzt als Beispiele Wachs oder Brotteig. Er erkennt, das es
Fließ-Bewegungen sein müssen.
Eine schöne Beschreibung der Dynamik der Gletscher und ihrer Bildung. Es
ist natürlich der typische "Roßmäßler- Stil": "Die Gletscher fasst
man gewöhnlich als das Bild der starren Todesruhe auf, und doch...".
Original Text von
Roßmäßler (1863) :
p.63:
Die Dynamik der Gletscher:
Wir lernten in zahlreichen und mannigfaltigen Fällen das Wasser als eine
Macht kennen, welche bald in jäher Entfaltung Zerstörung um sich
verbreitet, bald ihren Einfluß wie schleichende Diplomatie in für den
Unterliegenden unmerkbarer Allmähligkeit geltend macht.
Die letztere Handlungsweise liebt auch ganz besonders das Wasser im
Zustande der Erstarrung, das Eis. Das millionenfache Zerklüften der
Felsen durch gefrorene Wasseräderchen in der Oberfläche derselben
lernten wir schon kennen. Ein großartiges Gegenstück, und doch nicht
minder verborgen wirkend, bilden die Gletscher.
Die Gletscher faßt man gewöhnlich als das Bild der starren Todesruhe
auf, und doch sind sie weit mehr ein Gleichnis der Macht, welche im
unablässigen, sich verbergenden Beharren liegt. Sie sind nichts weniger
als bewegungslos. Ich denke dabei nicht an die zerstörende
Lawine, denn die hat mit der Gletscherbildung nichts zu tun.
Die Naturgeschichte der Gletscher hat erst in neuerer
Zeit eine so vollständige Aufhellung erfahren, daß man jetzt ganz
vertraut ist mit dem dämonischen Leben, welches diese im ewigen Wandel
begriffenen Riesenmassen beseelt. Sie spielten ohne Zweifel dieselbe
Rolle wie jetzt, nur vielleicht großartiger, auch in der
vorgeschichtlichen Zeit, und manche Erscheinungen aus der
Diluvialperiode, welche lange unerklärbar waren, sind als das Werk der
Gletscher erkannt worden. Namentlich sind drei Gletscher Jahre lang
einer fortgesetzten, mit Gefahren und Entbehrungen mancherlei Art
verbunden gewesenen Beobachtung unterzogen worden, der Glacier des Bois
in Chamouni durch den Engländer Forbes, der Unteraargletscher im Berner
Oberland durch Agassi; und der Parsterzengletscher in Tirol durch die
Gebrüder Schlagintweit. Durch diese Untersuchungen hat man endlich auch
die Erscheinung der Gletscherbewegung richtig gedeutet und dabei
zugleich erfahren, weshalb diese Deutung nicht früher gelungen ist. Wir
werden erfahren, daß hier einmal die am natürlichsten scheinende und
zunächst liegende Deutung nicht die richtige war, sondern daß das
Gletscher-Eis eine Eigenschaft besitze, die man ihm, an anderes Eis
denkend, nicht zuschreiben konnte. Bei der Großartigkeit der Erscheinung
und der geologischen Bedeutung der Gletscher wird es vollkommen
gerechtfertigt sein, wenn wir ihnen jetzt eine besondere Aufmerksamkeit
zuwenden.
Die erste Bedingung zur Gletscherbildung ist die
Erhebung der sie tragenden Berge bis über die Schneegrenze
hinaus. Diese ist bekanntlich nicht auf allen Punkten der Erdoberfläche
dieselbe, sondern liegt je näher dem Äquator desto höher, je näher den
Polen desto tiefer. Während auf der Insel Island die Grenze des ewigen
Schnees in etwa 3200 Fuß Höhe über dem Meere liegt, steigt sie unter dem
Äquator bei Quito bis auf 16,000 Fuß; in Mitteleuropa liegt sie zwischen
7000 und 8000 Fuß.
Doch hängt sowohl die Schneegrenze als noch mehr die Gletscherbildung
nicht allein von der Seehöhe ab, sondern es kommen dabei auch einige
andere Einflüsse in Betracht, z. B. die Umgebung des Berges, die
Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luftschichten, die mittle
Jahrestemperatur, die Richtung der herrschenden Winde und namentlich
hinsichtlich der Gletscher die Richtung der Bergwand gegen Nord oder
gegen Süd.
Die zweite Grundbedingung zur Gletscherbildung ist eine etwas, aber nur
wenig geneigte kesselartige Weitung in einem Gebirgsstocke,
damit in ihr der fallende Schnee sich in großen Massen häufen könne, aus
welchem dann das Gletschereis sich bildet. Hierdurch berichtigt sich die
sehr verbreitete falsche Ansicht, daß die höchsten zackigen Kuppen der
den ewigen Schnee tragenden Alpen die Gletscher seien. Im Gegenteile
liegen oder endigen wenigstens dieselben immer an der unteren Grenze der
Schneeregion, und immer grenzt unmittelbar an den Fuß des Gletschers die
bekannte prangende Schönheit der Alpenkräuter und selbst nicht selten
das Getreidefeld und der Obstbaum.
Die Schneefelder, welche im Hintergründe der hohen Alpentäler
liegen, sind die Vorratsbehälter, aus denen die Masse zu der
Gletscherbildung Herabtritt, und man kann daher einen Gletscher mit
einem Flusse und das ihn bildende Schneefeld mit einem See vergleichen,
von welchem der Fluß gespeist wird.
Man muß sich die Örtlichkeit nicht so denken, daß der Boden, auf welchem
der Gletscher ruht, sehr geneigt sei: im Gegenteile ist die Grundfläche
des Gletschers von vollkommener Ebenheit oft so wenig verschieden, daß
das messende Auge die Bodenneigung kaum wahrnimmt. Gletscher mit
stärkerer Neigung, welche dann auch nicht in Talkesseln eingebettet
liegen, sondern in großer Ausdehnung an den Seiten der Hochgebirge
hängen, nennt man Gletscher zweiter Ordnung, während jene nur sanft
abhängigen, von Bergwänden eingeschlossenen die Gletscher erster Ordnung
bilden.
Die Umwandlung des gefallenen Schnees in Gletschereis
geht nicht unmittelbar von Statten; es muß vielmehr vorher die
Mittelstufe des Firn durchlaufen. Dazu bedarf es unter allen
Verhältnissen der Firnmulde, einer flach ausgehöhlten, oberhalb
unmittelbar an das Schneefeld angrenzenden Fläche, in welcher die
Umwandlung des Schnees in Firn vorgeht, und welche immer einen
beträchtlichen Umfang haben muß, um einen Gletscher erster Größe zu
bilden; man meint, mindestens eine Weite von 7000 Fuß und einen
Flächenraum von 16.000.000 Quadratfuß. Der Schnee, welcher in den Höhen
über der Schneegrenze fällt, und deshalb Hochschnee genannt wird, ist
von dem Schnee des ebenen Landes sehr verschieden. Er besteht nicht aus
den zierlichen Sternen sondern meistens sehr kleinen Stäbchen und
Nädelchen und ist daher sehr fein und trocken, ein leichtes Spiel der
Winde, die ihn in dem Schneefelde zusammenhäufen. Ganz ähnlicher Schnee
fällt in der Ebene nur in den seltenen Fällen, daß es bei großer Kälte
schneit. Durch Einwirkung der Tageswärme schmilzt der Schnee zu Körnern
zusammen und wird so zum Firn. Eine ähnliche oder vielmehr dieselbe
Erscheinung können wir jedes Jahr auch in der Ebene beobachten, wo vor
dem gänzlichen Schmelzen der Schnee ebenfalls durch oberflächliche
Zusammen- Schmelzung grobkörnig wird und sich sogar meist auch vor dem
Zerfließen in Wasser in ein lockeres Eis verwandelt. Maki kann daher
beim Eintritt des Frühjahres an jeder Grabenböschung wenigstens einige
Stufen der Gletscherbildung im Kleinen kennen lernen.
Hierdurch gibt sich der beträchtliche Unterschied des Gletschereises von
gefrorenen, Wasser kund, daß jenes, auch wenn es noch so dicht scheint,
doch ursprünglich aus zusammen-gefrorenen Körnern besteht, während
Wassereis, eine gleichartig dichte Masse ist, welche freilich nicht
selten Luftbläschen und fremdartige Körperchen umschließt. Doch kommt in
der obersten Gletscherregion ein ausgezeichnet dichtes und hartes Eis
vor, das sogenannte Hoch-Eis, welches dadurch entsteht, daß bei starker
Sonnenwärme von der Schnee- feld-Oberfläche viel Schmelzwasser abgetaut
wird, welches den Schnee durchsickert und auf dem Boden des Schneefeldes
zu dem Hocheis gefriert.
Dieses Zusammenfrieren der Firnkörner zu Gletschereis wird durch das
nächtliche Gefrieren des Wassers bewirkt, welches den Tag über in den
oberen Firnschichten von den Körnern abschmilzt und in die Zwischenräume
der tieferen Firnschichten herabsickert. Je näher das Gletschereis dem
Firnfelde liegt, je ähnlicher also es dem Firn ist, desto mehr ist es
von Haarspalten durchzogen und desto mehr Luftbläschen enthält es. In
den ersteren kreisen immer feine Wasserströmchen, welche des Nachts
frieren; letztere werden von der Last der nachschiebenden Hinteren
Massen je weiter nach dem Gletscherfuße desto mehr durch Druck
beseitigt, so daß das Eis am Gletscherfuße nur noch aus groben
Bruchstücken dicht zusammengesetzt erscheint.
Wäre das Gletschereis eine ebenso dichte gleichförmige
Masse wie das Wassereis, und beruhte die Bewegung, das Abwärtsgleiten
des Gletschers, nur auf dem Drucke des Firnfeldes und aus der Schwere
des Gletschers selbst, so müßte eine Erscheinung stattfinden, welche
eben nicht vorhanden ist. Wenn nämlich das Tal, in welchem der Gletscher
ruht, sich nach unten verengt, zusammenzieht, so müßte entweder dadurch
der Gletscher aufgehalten werden, oder, wenn der Druck diese aufhaltende
Macht überwände, so müßte der Gletscher an seinen Rändern zertrümmert,
gewissermaßen das die Breite der Talverengerung Überschreitende
desselben abgestoßen und hinter der Verengerung des Tales zurückbleibend
aufgehäuft werden. Dann würde der Gletscher von der Verengerung des
Tales an die durch diese erfahrene Beschneidung, um diese Bezeichnung
anzuwenden, beibehalten. Die beistehende, natürlich bloß erdachte,
Zeichnung, Fig. 15, wird uns dies ganz anschaulich
machen. Sie ist von dem gedachten Standpunkte einer hohen Bergspitze von
dem Fuße des Gletschers aus aufgefaßt, und zeigt uns unter einer
Verengerung der Gletscherbahn rechts den Gletscher in seiner Fortsetzung
so beschnitten, wie er es sein müßte, wenn das Gletschereis starr wäre.
Links sehen wir das Schema der Wirklichkeit gemäß dargestellt, die wir
in dem Folgenden kennen lernen werden.
Von alledem bemerkt man das Gegenteil. Der Gletscher schmiegt sich
seinen ganzen, oft mehrere Stunden betragenden Lauf entlang allen
Formen, allen Erweiterungen und Verengerungen seines Tales an. Er ist
gewissermaßen dem Wachs zu vergleichen, welches als starre Masse in eine
künstlich nachgebildete, ein wenig geneigte, bald engere bald weitere
Gletscherbahn gelegt und der Sonnenhitze ausgesetzt, ebenfalls langsam
darauf herabfließen und dabei sich nach der Bedingung der Bahn bald
zusammenziehen bald ausbreiten würde. Brotteig würde denselben Erfolg
noch schneller zeigen und die Beweglichkeit des Gletscherfeldes am
besten veranschaulichen.
Diese Schmiegsamkeit des Gletschers wäre bei einem
starren Zustande seiner Masse vollkommen unerklärlich; sie setzt
vielmehr eine Verschiebbarkeit des Gletschereises in seinem inneren
Gefüge, eine Plastizität mit Notwendigkeit voraus und man darf daher
nicht sagen, daß der Gletscher von seiner eigenen Schwere oder von dem
Druck des Schnee- und Firnfeldes abwärts geschoben werde, sondern daß er
abwärts fließt, so sehr sich auch ein Blick auf sein starres Eisgefilde
anfangs gegen diese Auffassung sträuben mag.
Es steht auch ganz im Einklang mit dieser Auffassung, daß die
Gletschermasse in ihrer Mitte sich stets etwas schneller bewegt, als an
den Rändern: ebenso wie in einem Strome das Wasser in der Mitte auch
schneller als am Ufer fließt. Beide Erscheinungen beruhen auf demselben
Gesetze, auf dem des Widerstandes, welchen die Reibung auf einen
bewegten Körper ausübt, und zwar hier die Reibungen der beiden Ufern.
Die Schnelligkeit der Gletscherbewegung, und daß er
sich überhaupt bewege, hat man durch Querreihen von Signalstangen leicht
zur augenfälligen Gewissheit erheben können. Man steckte quer über den
Gletscher eine schnurgerade Reihe von Stangen, deren beide äußerste auf
den Felsenufern des Gletschers feststanden. Nach einiger Zeit waren
nicht nur die Uferstangen, um sie so zu bezeichnen, zurückgeblieben,
sondern die Gletscherstangen bildeten auch einen abwärts gekrümmten
Bogen, was ein deutlicher Beweis von der schnelleren Bewegung des
Gletschers in seiner Mitte ist.
Wenn so die Bewegung der Gletscher und der Grund
derselben, der in fortwährender Umbildung und Verschiebbarkeit ihrer
Masse liegt, festgestellt war, so konnte man sich auch leicht einige
andere Erscheinungen erklären, die sogar selbst wieder zu Beweisen für
die Bewegung wurden.
Da jeder Gletscher ununterbrochen an seinem oberen Ende aus dem Firn
ungefähr eben so viel Ersatz erhält, als er am unteren durch Abschmelzen
verliert, er also in gewissem Sinne ebenso wie seine Bewegung ewig ist,
so müssen auch die Wirkungen, die er auf seine Umgebung ausübt,
unablässig sein. Diese sind sehr bedeutend.
Eine so gewaltige Last, welche ein oft 1000 Fuß dickes
und noch viel breiteres und stundenlanges Eisfeld ist, muß auf ihre
Unterlage, auf und an welcher sie ohne Unterlaß fortrutscht, einen
furchtbaren Druck und zugleich, eben weil sie sich bewegt, eine
zertrümmernde Reibung ausüben. Alles, was an lose liegenden oder
ablösbaren Steinen sich unter ihr befindet und zum Teil an ihrer unteren
Fläche festfriert, muß teils zermalmt und zerrieben werden, teils auf
die Umgebung zermalmend, abschleifend wirken. Daher findet man
namentlich die Felswände, an denen der Gletscher hingleitet, immer
abgeschliffen. Diese Schliff-Flächen unterscheiden sich aber von den
durch Wasserfluten bewirkten, die wir früher kennen lernten, immer durch
vertiefte Furchen, Streifen und Ritzen, hervorgebracht durch harte
Körnchen und Steine und Blöcke, welche im Gletschereis eingefroren oder
sonst wie an seiner Oberfläche haftend, ähnlich wirken müssen, wie die
Zähne einer Raspel. Ein kühner Gedanke, und doch buchstäblich wahr: die
Gletscher feilen sich ihre Talgassen glatt, und man sieht an diesen die
Feilstriche wie an der Arbeit des Schlossers.
[Weiter
im Text von Rossmässler]
Geschichte der Geowissenschaften
Allgemeine Geologie
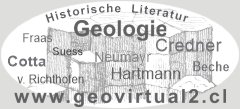
español - deutsch
Gletscher und Eiszeiten:
Gletscher Zermatt (Burmeister, 1851)
Zermatt-Gletschers (Beche, 1852)
Gletscher am Ozean (Beche, 1852)
Humboldt-Gletscher (Ludwig, 1861)
►
Bildung eines Gletschers (Roßmäßler,
1863)
Gletscher in Bewegung (Credner, 1891)
Arten von Gletscherspalten (Credner, 1891)
Aar-Gletscher, Beispiel (Beche, 1852)
Gletscher, Schweiz (Ludwig, 1861)
Gletscher, Zentralmoräne (Roßmäßler, 1863)
Gletscher und Moränen (Siegmund, 1877)
Gletscher Monte Rosa (Lippert, 1878)
Idealer Gletscher (Credner, 1891)
Endmoräne eines Gletschers (Vogt, 1866)
Text: Dynamik der Gletscher (Fritsch, 1888)
Ende des Rhone-Gletschers (Fritsch, 1888)
Rundhöcker bei Grindel (Fritsch, 1888)
Rundhöckerlandschaft (Neumayr, 1897)
Der Unteraargletscher (Fritsch, 1888)
Moräne, Schweizer Alpen (Fritsch, 1888)
Text: Wirkung des Eises (Neumayr, 1897)
Gletscher in Bewegung (Neumayr, 1897)
Erosion, Transport, Gletscher (Neumayr, 1897)
Biografien
der Autoren
E. A.
Roßmäßler 1863
Download PDF:
![]()
Roßmäßler (1863): Die Geschichte der
Erde, korrigiert (Teil 1)
Einführung Allgemeine Geologie (span.)
Gletscher und Eis
Virtuelles Museum (esp.)
Flusssysteme
Meer und
Ozean
![]()
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte der Geowissenschaften
Geschichte Allgemeine Geologie
Geschichte Paläontologie
Geschichte der Lagerstättenkunde
Inhalt
Geschichte der Tektonik
Inhalt Bergbau-Geschichte
Biografien
der Autoren
Wörterbuch, Begriffe
Download Zentrum

